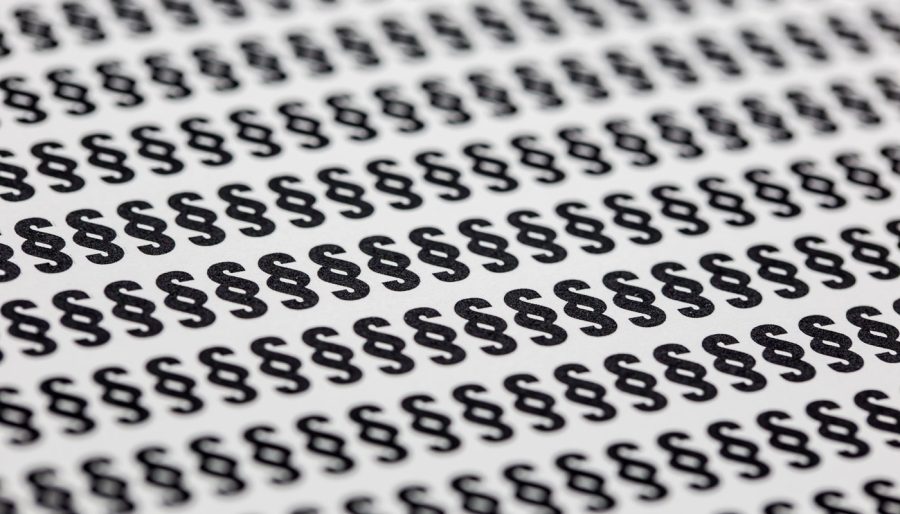Staatliche Eingriffe wie das Lieferkettengesetz schränken die unternehmerische Freiheit ein. Diese massiven Berichtspflichten und enormen Kostenbelastungen schmälern letztlich unseren Wohlstand.
Text: Christoph M. Schneider

Geschäftsführer Economica GmbH
Es geht in diesem Zusammenhang hauptsächlich um die Europäische Gesetzgebung, wo man versucht, die ESG-Compliance-Thematik auf europäischer Ebene zu regulieren. Und die einzelnen Länder sind bemüht, dies entsprechend umzusetzen. Dabei hat man gesetzlich zwar große Ausnahmen für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gemacht, aber das ist aus zwei Perspektiven Unsinn. Zum einen ein faktischer. Denn ein Großunternehmen hat Zulieferer, und diese haben komplett unterschiedliche Größen, sei es der Lieferant eines Bleistift fürs Büro oder der einer großen Maschine zur Fertigung. Und in dem Moment, wo man ein Zulieferer ist, ist man in dieser Lieferkette und muss Herausforderungen, die einem Produzenten gestellt werden, auch als Zulieferer automatisch erfüllen, sonst fällt man aus dem Zuliefernetzwerk heraus. Nur ein ganz einfaches, kleines Beispiel: Auch wir als Wirtschaftsforschungsinstitut sind Zulieferer für große internationale Unternehmen, werden da als „Supplier“ angelegt und müssen all diese Compliance-Anforderungen von den großen Unternehmen erfüllen – und die sind enorm ausführlich. Ich muss als Geschäftsführer der Economica praktisch Compliance-Lehrgänge von großen Unternehmen durchmachen. Ich muss stundenlang am Laptop sitzen und mich durchklicken durch Voraussetzungen und Belehrungen, die dann abgeprüft werden. Ich kann das nicht einmal delegieren, da es vom Großunternehmen direkt und nur vom Geschäftsführer verlangt wird.
Hier entstehen Kosten, und zwar drei verschiedene Arten von Kosten. Einmal ist es der Personalaufwand für die Einhaltung der Compliance eben nicht nur in den betroffenen Großunternehmen, sondern auch in jenen der Zulieferer. Dann – der Investitionsaufwand, ich muss Kapital einsetzen, muss extra Geld in die Hand nehmen, um hier alles zu machen, von der Sicherstellung, dass meine Mitarbeiter die Compliance von diesem Großunternehmen einhalten können, bis hin zu dem Aufwand für eine entsprechende Automatisierung in meinem Unternehmen. Dafür muss ich Computer und Software einkaufen, ich muss Geräte beschaffen und so weiter. Und oftmals kommt eine dritte Kostenkomponente dazu, nämlich ein externer Beratungsaufwand, wenn man es als KMU alleine nicht schafft.
Wir haben uns den Unterschied zwischen Muttergesellschaft und Tochtergesellschaft angeschaut und gesehen, dass beim Lieferkettengesetz die Tochtergesellschaften auch entsprechend (zwar etwas weniger aber dennoch) betroffen sind. Wenn also die Tochtergesellschaft schon betroffen ist, dann ist es logischerweise auch ein anderer externer Zulieferer. Die genannten drei Kostenkomponenten sind sowohl bei dem Großunternehmen wie bei der Tochtergesellschaft oder bei dem KMU festzustellen. Wobei die Personalkosten meistens bei den Kleineren größer sind als bei den Großunternehmen bzw. bei der Muttergesellschaft. Diese haben eher mehr Kapitalaufwand, auch mehr Beratungsaufwand, weil sie die Erstbetroffenen sind. Aber sie legen sich zumeist speziell entwickelte Methoden oder Programme zurecht, um die verlangten Ansätze erfüllen zu können. Deswegen sind die Investitions- und die Beratungskosten bei KMU wahrscheinlich etwas weniger, weil ein Teil der Beratung dann aus dem jeweiligen Großunternehmen für den Zulieferer erfolgt. Aber Personalkosten und Zeitaufwand sind dadurch dann der größere Ansatz bei KMU.
Gegen das Grundrecht des freien Unternehmertums
Mit anderen Worten: Es ist zu 100% praktische Tatsache, dass man, auch wenn man nicht vom Gesetz direkt betroffen ist, als ein registrierter „Supplier“ (Zulieferer) für ein Großunternehmen indirekt betroffen ist. Und das zweite ist eigentlich ein Imageschaden. Allein, dass man KMU ausnimmt aus dem Gesetz, ist ein angedeuteter und wahrgenommener Imageschaden, weil es suggeriert, dass KMU entweder nicht fähig sind, die Compliance-Voraussetzungen einzuhalten, oder dass sie offensichtlich irgendwelche „nicht konforme“ Geschäftspraktiken verfolgen.
Durch diese Art von staatlichen Eingriffen wie dem Lieferkettengesetz sinkt die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Unternehmen.
Und es kommt noch etwas zum Tragen, und dazu gibt es langsam auch innerhalb von Europa Meinungen dazu, auch aus der Wissenschaft. Und zwar: In den meisten europäischen Ländern Europas, auch in Österreich, gibt es Grundrechte wie die Berufsfreiheit, die Freiheit, ein Gewerbe auszuüben. Das ist in unserer Verfassung verankert. Diese Prinzipien sind damals, als die EU gegründet worden ist, auf diese übertragen worden. Deswegen ist das Recht der Berufsfreiheit auch in Artikel 16 in der Charta der Grundrechte der EU verankert. Und mit dem Berufsrecht ist das freie Unternehmertum verbunden. Das heißt: Natürlich muss man sich an die Gesetze halten, an die Ordnungspolitik, aber im Grunde genommen sollten wir im unternehmerischen Handeln frei sein bzw. frei unternehmerische Entscheidungen treffen können. Doch immer mehr entsteht sowohl unter Juristen wie auch in der Wissenschaft die Meinung, dass mit diesen extremen Compliance-Anforderungen in die Prozesse und das Verhalten innerhalb eines Unternehmens eingegriffen wird. Und das ist eigentlich gegen das Grundrecht der Berufsfreiheit bzw. des freien Unternehmertums. Ein gewisser Udo di Fabio, Hochschulprofessor in Bonn, hat das in einem Gutachten, das unlängst von der deutschen Stiftung Familienunternehmen in Auftrag gegeben wurde, untersucht und kommt genau zu diesem Schluss.
Maßregelungen wie in der Schule
Durch diese Art von staatlichen Eingriffen wie dem Lieferkettengesetz sinkt die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationskraft der Unternehmen. Warum? Weil man so gemaßregelt wird wie in der Schule, so dass man, wenn man eine Antwort weiß, diese gar nicht mehr sich traut auszurufen. Und was wird man dann machen? Man wird sein Verhalten komplett daran anpassen. Das heißt, man wird nur mehr extrem abgesicherte und langzeitvertraute Zulieferer nehmen, die, die man kennt und die sich in direkter Nähe befinden. Als Unternehmen wird man seine Investitionsaktivität minimieren auf jene Dinge, von denen man immer 100% sicher ist, dass kein Problem für einen entstehen kann.
Nicht zu vergessen – es sind zwei Dinge, die da von der Europäischen Union gemacht werden: Auf der einen Seite werden neue Regeln aufgestellt, die die Kosten der unternehmerischen Tätigkeiten erhöhen, aber es ist auch so, dass man für den kleinsten Fehler, den man macht, gleich massiv bestraft wird – beim Lieferkettengesetz sind das 5% des Umsatzes. Und es wird dabei der gesamte Umsatz, den man weltweit macht, für das Strafausmaß herangezogen, nicht nur der Umsatz im Zusammenhang mit dem einen Vertrag, wo man möglicherweise unabsichtlich eventuell einen Fehler gemacht oder eine Verletzung des Gesetzes verursacht hat. Man ist auch nicht gleich ein Krimineller, wenn man einmal eine Parkstrafe bekommt oder die Geschwindigkeit etwas überschreitet. Da muss man nicht gleich das Auto und den Führerschein hergeben.
Extrem belastend für das volkswirtschaftliche System
Das schränkt natürlich das unternehmerische Verhalten ein. Deswegen verursacht eine Maßnahme wie das Lieferkettengesetz und andere ähnliche Compliance Maßnahmen der letzten und kommenden Zeit nicht nur höhere Kosten und Unsicherheiten, sondern im Endeffekt auch höhere Preise. Die Inflation wird durch solche Gesetze und Maßnahmen angetrieben. Und im Endeffekt gibt es weniger Planbarkeit für die Unternehmen. Als Konsequenz werden Investitionen, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit eingeschränkt. Und es wird zu weniger Konsum kommen. Auch die Konsumenten sind dann betroffen von dem Ganzen. Es gibt weniger Auswahl bzw. Angebot, und im Endeffekt werden wir weniger Wirtschaftswachstum und weniger Wohlstand haben. Das Ganze ist ein Kreis, der wirklich extrem belastend ist für das ganze volkswirtschaftliche System. Wir wissen auch, dass diese massiv kontrollierten Systeme, wo man keine Freiheiten zulässt, weder unternehmerische noch sonstige, in der Vergangenheit alle gescheitert sind. Diese Einschränkungen der unternehmerischen Freiheit, diese massiven Berichtspflichten und enormen Kostenbelastungen – das schmälert letztlich unseren Wohlstand.
Maßnahmen wie das Lieferkettengesetz und Compliance Maßnahmen verursachen nicht nur höhere Kosten und Unsicherheiten, sondern im Endeffekt auch höhere Preise.
Im Endeffekt geht es um die Frage, „Was darf ich wirklich noch machen?“ Ich bin auch in der Industriellenvereinigung verantwortlich für die Plattform Familienunternehmen und habe daher Einblick in die Familienunternehmen, und das sind 80% der Unternehmen. Diese haben in ihrer Historie und in ihren Grundprinzipien ohnehin schon eine interne Compliance, sprich: eine Verpflichtung zur Nachhaltigkeit für die Generationen. Ein Familienunternehmen ist also per Definition schon der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit verpflichtet. Und jetzt kommt ein Entscheidungsträger bzw. die Politik von außerhalb her, greift in die Aktivität und Prozesse des Unternehmens ein und sagt, wie es sich zu verhalten hat. Man nennt das in der Fachsprache „implementiven Steuerungsansatz“.
Was kann man da tun? Die Betroffenen, entweder einzeln oder durch ihre Verbände und Vertretungen, haben sich bereits kritisch zu Wort gemeldet. Und sogar die Europäische Kommission hat offensichtlich erkannt, dass man da zu weit gegangen ist. Das Problem ist, dass man diese Versuche nicht abschafft. Es wäre jedoch wichtig zu erkennen, dass man hier fehlerhaft vorgegangen ist, und nun etwas, das nicht zu einem besseren Ergebnis für das Volk und die Volkswirtschaft führt, eben wieder zurücknimmt. Dabei sind diese Omnibus-Verfahren, welche die Europäische Kommission jetzt eingeleitet hat, wenigstens erste wichtige Schritte in eine bessere Richtung.
Etwas, das nicht zu einem besseren Ergebnis für das Volk und die Volkswirtschaft führt, sollte wieder zurückgenommen werden.
Gesteigerte Nutzung der Digitalisierung kann helfen
Es ist in den letzten fünf Jahren von der Europäischen Kommission eine dichte Abfolge an Rechtsakten zu diesen Compliance-Themen herausgekommen, wie es noch nie davor der Fall war. Und das wird auch nicht aufhören, im nächsten Jahr soll auch noch die Lohntransparenzrichtlinie kommen, die man als Unternehmen einhalten muss, also wieder neue Berichtspflichten. Man lernt offensichtlich nicht aus Fehlern. Wir haben für die Mehrheit dieser Thematiken ohnehin schon andere Gesetze, wir haben Arbeitnehmerschutzgesetze, Konsumentenschutzgesetze, wir haben Gesetze, die die Sicherheit garantieren, auch entlang der Wertschöpfungskette, wir haben Betriebssicherheitsgesetze, uva. Da muss man ganz ehrlich sagen: Bevor man irgendeine neue Auflage in Kraft setzt, müsste man die Konsistenz und die Logik aller schon vorhandenen Gesetze und Vorgaben prüfen, ob man das wirklich braucht bei dem aktuell bereits sehr hohen Bestand.
Was kann man machen in der Situation, in der wir gerade sind? Was uns wirklich helfen kann, ist eine gesteigerte Nutzung der Digitalisierung. In der Verwaltung müssten die fortschrittlichsten Anwender der Digitalisierung tätig sein, die es gibt. Aber eben auch deswegen ist die Problematik für die KMU viel größer. Denn nach einer Evidenz von Eurostat, wo der Digitalisierungsgrad der Unternehmen nach Unternehmensgröße gemessen wird, also die Verwendung von Digitalisierung und die Investitionen in Digitalisierung, nimmt mit abnehmender Unternehmensgröße auch der Digitalisierungsgrad ab.
Wenn man Gesetze einführt, wäre auch folgendes wichtig: Mit den Gesetzen wurde auch die so genannte Gesetzesfolgekostenabschätzung eingeführt. Aber die wird, meine ich, eher stiefmütterlich befolgt. Wenn diese Gesetzesfolgekostenabschätzung rigoros und transparent und öffentlich durchgeführt werden würde, dann würde man auch objektiver entscheiden, ob man ein neues Gesetz tatsächlich braucht oder nicht. Dieser Teil wird aber einfach ausgespart und es wird das neue Gesetz beschlossen.
Wenn man die Gesetzesfolgekostenabschätzung für das Lieferkettengesetz auf europäischer Ebene gemacht hätte – vielleicht sollte das auf europäischer Ebene auch verpflichtend eingeführt werden –, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man im Parlament diesem Lieferkettengesetz zugestimmt hätte.
Und ein letzter Punkt noch: Es gibt so viel Daten, die überall eingehoben werden, allein von der Finanzbehörde werden enorm viele Daten eingehoben. Diese Daten werden nicht geteilt mit anderen Institutionen. Dabei könnte man enorm viel von schon bestehenden Daten verwenden, man könnte das dann mit Sekundärdaten abdecken und müsste viel weniger die Unternehmen zu Berichten oder Einmeldungen auffordern und würde damit die Belastung ganz deutlich senken.
Mag. Dr. Christoph M. Schneider ist Geschäftsführer von der Economica GmbH